„Ein von Schatten begrenzter Raum“ von Emine Sevgi Özdamar, Suhrkamp Verlag, ist in der Kategorie Belletristik für den Bayerischen Buchpreis 2021 nominiert. Die Rezension ist Teil meiner Auseinandersetzung mit allen zur Wahl stehenden Büchern, da ich die Preisverleihung auch in diesem Jahr als Literaturblogger offiziell begleiten darf. Auf meiner Projektseite findet man alle relevanten Hintergründe zum #baybuch, die nominierten Werke und die Rezensionen der drei Buchpreisblogger:innen. Voller Spannung fiebern wir dem Ergebnis der Jury-Debatte entgegen, die am 11. November über die Preisträger:innen entscheiden wird.
Update 11. November 2021: So sieht eine Siegerin aus!
Da liest man die Romane, die für den Bayerischen Buchpreis 2021 nominiert sind und stellt fest, dass zumindest die Autorinnen Jovana Reisinger und Jenny Erpenbeck in ihren Werken schnell zum Kern ihrer Geschichte vordringen. Sie entwickeln, jede für sich, einen Sog, der die geneigte Leserschaft schon von Beginn an zu fesseln weiß. Es wundert daher nicht, dass sowohl die „Spitzenreiterinnen“ als auch „Kairos“ von einer Dynamik getragen werden, die den jeweiligen Erzählgegenständen Rechnung trägt. Als ich mich nun der dritten Nominierten im Bunde näherte, ahnte ich schon, dass aufgrund des Volumens von mehr als 750 Seiten absolut kein Grund zur Eile vorliegen würde. Ich irrte mich nicht. „Ein von Schatten begrenzter Raum“ von Emine Sevgi Özdamar ist das Schwergewicht unter den nominierten Werken und lässt die Konkurrenz recht dünn aussehen. Die „Spitzenreiterinnen“ begnügen sich mit 257 Seiten, „Kairos“ endet auf Seite 379. Hat Emine Sevgi Özdamar so viel zu erzählen? Wie erzählt sie es und kann ich der in Berlin lebenden Schriftstellerin und Schauspielerin mit türkischen Wurzeln in ihre Geschichte folgen? Ich war gespannt…
Es wird schnell klar, dass Emine Sevgi Özdamar aus dem Vollen schöpft. Aus dem vollen Fundus ihres eigenen Lebens, aus dem vollen Schatz ihrer Erfahrungen und aus den prachtvollen Requisiten, die sie in den vergangenen Jahrzehnten angehäuft hat. In Wahrheit wird es jedoch nicht schnell klar, was sie uns erzählen will, weil sie sich jedem Tempo in ihrem Roman verweigert. Es fühlt sich an, wie eine orientalische Geschichte, in der wir gebeten werden, Platz zu nehmen, einen Tee zu trinken, zuzuhören, den Tee zu genießen und immer wieder Pausen zuzulassen, um dem eben Gehörten Raum zu geben. Es ist poetisch und traumwandlerisch sicher, wie uns die Autorin auf jene Inseln entführt, die den Startpunkt ihrer Suche nach sich selbst, ihrer Identität und den Rollen darstellen, die sie künftig spielen wird. Es ist der erste Aufzug eines Lebenstheaters, in dem sie die Hauptrolle spielt, ohne es jemals wahrhaben zu wollen. Es ist der erste Akt einer Vorstellung, die mit einer alternativlosen Flucht beginnt.
Es ist die Dynamik der erzeugten Sprachbilder, die das Lesen beflügelt. Ich fühle:
„Das Morgenlicht draußen, das mit einem Bein noch in der Nacht stand…“
Ich höre die Geräusche der Nacht, den rastlos rebellierenden Esel, die Motoren aller Boote auf dem Meer und die Orthodoxkirche, die plötzlich zu sprechen beginnt. Ich bin Gefangener einer Szenerie, die keine Kulisse ist. Ich folge Emine Sevgi Özdamar auf ihrer Flucht. Nichts wie weg aus der Heimat. Raus aus der Türkei, die in sich kollabiert. Eine Heimat, die alle vereinen sollte, die doch so unvereinbar sind. Griechische Türken und türkische Griechen. Armenier, Aleviten, Kurden. Zu viel für eine Heimat. Im Putsch entlädt sich die geballte Gewalt. Das Militär regiert, Hubschrauber dominieren das Bild und der Kultur werden die Riegel vorgeschoben. Es eng für die namenlose Erzählerin. Was bleibt ist die Flucht. Träume und Hoffnungen im Gepäck. Und nicht nur das. Man geht niemals ohne die eigene Geschichte aus der Heimat fort und so will auch sie den Reichtum ihrer kulturellen Identität retten. Schweres Gepäck auf zarten Schultern. Und das in einer Zeit, in der dem türkischen Leben in Europa ein Makel anhaftet. Gast darf man sein. Gastarbeiter gerne. Zuhause? Bitte nicht.
Ja, die Autorin hat viel zu erzählen. Schlichtweg ihr ganzes Leben liegt hier in der autobiografischen Waagschale. Ebenso, wie die Geschichte des vorliegenden Buches. Wir folgen ihr nach Berlin, erleben die Wanderin zwischen zwei Welten, weil sie Ost und West mit ihrem Ausweis wechseln darf, wie abgelegte Klamotten. Wir erleben ihre Sicht auf ein vergiftetes Deutschland, in dem man seine Toten nicht mehr findet. Sieht sie an Gedenkstätten ohne Opfer und fürchtet sich mit ihr vor den Schatten…
„Sie wachsen ineinander bis zu einem großen Schattenklumpen, der sich vom Tisch bis zu ihren Füßen verlängert und um ihre Füße herum sich mit dem Schatten der Stuhlbeine verbindet. Der Rest des Raumes ist ohne Schatten. Deswegen sieht es nur dort, wo der Schatten gewachsen ist, wie ein Raum aus, ein von Schatten begrenzter Raum.“
Sie setzt den Schatten das Licht der Theater entgegen, lebt in der Gesellschaft der großen Regisseure und Akteure auf, geht nach Paris, befreit sich von toxischen Bildern eines Deutschlands, das sie als „Draculas Grabmal“ empfindet. Die Autorin erzählt von einigen Suchen zugleich. Liebe, Heimat, Anerkennung. Sie berichtet nicht nur von der Flucht aus ihrem Land, sondern von den Fluchten vor der eigenen Bestimmung. Es sind Prophezeiungen, die der Erzählerin folgen. Es ist ihre Vorstellung, dass Vorstellungen in den großen Theatern in Berlin und Paris nur Raum für ihre Rolle als Putzfrau lassen. Es sind Überlebensängste, die sie auf Schritt und Tritt begleiten und es ist der verzweifelte Versuch, nach Hause zurückzukehren. Den Eltern zu begegnen und festzustellen, dass auch hier kein Platz mehr ist. Außer im Schuhkarton mit den Namen der Getöteten. Es schmerzt sehr, der Erzählerin auf ihrem Weg zu folgen und dabei zu erleben, dass sie sich selbst immer weiter von ihren Wurzeln entfernt. Und ganz nebenbei gelingt in aller Wehmut ein groß angelegter Theaterroman der vergangenen Jahrzehnte, in dem man großen Namen, kleinen Rollen, grandiosen Inszenierungen und Kulissen begegnet, die den Brettern, die die Welt bedeuten, Kontur verleihen.
Emine Sevgi Özdamar schreibt in ihrem groß angelegten Werk dagegen an, in die türkische Schublade einsortiert zu werden. Sie kämpft wortreich dagegen an, sie auf eine Herkunft und eine Nationalität zu reduzieren, ihr Gedächtnis auszulöschen und in einer anderen Kultur zu vereinnahmen. Sie schreibt uns ins Herz, dass es uns niemals egal sein darf, welche Geschichten unsere Mitmenschen erzählen. Sie hat sich selbst aus diesen Klischees befreit, indem sie ihnen Raum im Schattenraum gegeben hat. In dieser Begrenzung wirken diese Schatten bedrohlich, doch ein einziges helles Licht ist in der Lage, die Grenzen gänzlich neu zu ziehen. In gewagten Zeitsprüngen wagt sich unsere namenlose Erzählerin mehr als 30 Jahre in die Zukunft und beschreibt aus der Perspektive der Vergangenheit das Grauen der einstürzenden Türme des World Trade Centers, den Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo oder den ISIS-Anschlag auf den Flughafen von Istanbul. Vielleicht ist es so, dass wir in weiteren 30 Jahren alle Schubladen geschlossen haben, die zur Ausgrenzung von Menschen geeignet sind. Es wäre auch ein Verdienst dieses Romans. Hier lohnt die Ausdauer im Lesen, auch wenn ich mir einen ähnlich lesenswerten Roman mit maximal 500 Seiten sehr gut vorstellen kann. An einigen Stellen des Opus Magnus von Emine Sevgi Özdamar hatte ich schon ein wenig mit meiner inneren Unruhe zu kämpfen, die mich nach vorne treiben wollte.
Hier geht´s weiter mit den nominierten Autoren und Autorinnen
und ihren Werken in den Kategorien Belletristik und Sachbuch.
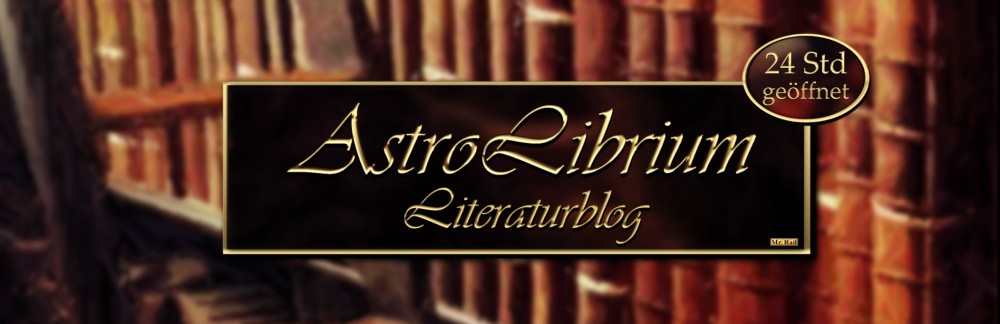













![Der Platz von Annie Ernaux [Das Hörspiel] - Astrolibrium](https://astrolibrium.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/der-platz_annie-ernaux_astrolibrium_5.jpg?w=584&h=381)
![Der Platz von Annie Ernaux [Das Hörspiel] - Astrolibrium](https://astrolibrium.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/der-platz_annie-ernaux_astrolibrium_7.jpg?w=584&h=381)
![Der Platz von Annie Ernaux [Das Hörspiel] - Astrolibrium](https://astrolibrium.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/der-platz_annie-ernaux_astrolibrium_2.jpg?w=584&h=381)
![Der Platz von Annie Ernaux [Das Hörspiel] - Astrolibrium](https://astrolibrium.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/der-platz_annie-ernaux_astrolibrium_4.jpg?w=584&h=381)
![Der Platz von Annie Ernaux [Das Hörspiel] - Astrolibrium](https://astrolibrium.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/der-platz_annie-ernaux_astrolibrium_6.jpg?w=584&h=381)
![Der Platz von Annie Ernaux [Das Hörspiel] - Astrolibrium](https://astrolibrium.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/der-platz_annie-ernaux_astrolibrium_3.jpg?w=584&h=381)











